• Tonträger
• CD-Tipps & Beste Alben
• Besuchte Konzerte
• Video / DVD
• Links zu Bands
• ROLLING STONE: Musik News
• HELMUT KRAUSSER
- Aktuelles
- Lesungen / Termine
- Werkverzeichnis
- Wer hat uns je geliebt?
- ![]() Freundschaft
Freundschaft
und Vergeltung
- Trennungen, Verbrennungen
- Zur Wildnis:
45 Kurze aus Berlin
- Puccini Roman
- Einsamkeit + Sex + Mitleid
- Eros
- Portrait
- Interviews
- Leseproben
- Lyrik
- Tagebücher
- Deutschlandreisen
- Kraussers Lieblingsbücher
- Krausser & Klassische Musik
- Der Komponist Helmut
-
Krausser
• BIBLIOTHEK / BELLETRISTIK
• MUSIKBIBLIOTHEK
Ein Interveiw von Patrick Großmann
Dieses Interview erschien in gekürzter Fassung in der Zeitschrift GALORE im Heft Mai 2005 und wurde von Patrick Großmann geführt.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung von GALORE und von Helmut Krausser.
Ich möchte mit einem Zitat aus einem Ihrer „Tagebücher“ starten: „Die Tragik meines Lebens besteht wohl darin, dass ich lieber Komponist geworden wäre als Schriftsteller. Damit ich selber losziehen, von mir aus auch scheitern könnte, denn nur etwas getan, probiert zu haben zählt am Ende.“ Geht das als Autor nicht ebenso?
Natürlich kann man auch als Schriftsteller etwas probieren – und damit scheitern. Es ging in dem Zitat um die Forderung nach Musik mit Melodie, die ich nur an andere stellen konnte, nicht an mich selbst. Der erste von Ihnen zitierte Satz hat damit zu tun, dass ich in der Tat glaube, für die Musik ursprünglich mehr Talent besessen zu haben, was allerdings meine ganze Jugend über brach lag. Es wurde nicht gefördert, und ich war selbst zu faul, ein Instrument zu erlernen. Von ein bissel Schrammelgitarre mal abgesehen. Dass ich wirklich begonnen habe, mich autodidaktisch auszubilden, das begann eigentlich erst, als die ersten primitiven Kompositionsprogramme für Computer aufkamen.
Wenn man Ihr Werk betrachtet, fällt auf, dass sich diese Liebe zur Musik nicht bloß durch zwei von Ihnen angefertigte Opern-Libretti sowie Ihre Ex-Rolle als Sänger der Rockband Genie & Handwerk belegen lässt, sondern auch quer durch Ihre Romane zieht.
Ich versuche generell, sehr melodiös zu schreiben. Gerade im Rahmen meiner lyrischen Selbstausbildung habe ich gemerkt, dass auch Sprache als Kunstform immer einem Zusammenspiel von Melodie und Rhythmus unterworfen ist. Insbesondere mit Vokalfärbungen – der Stellung der einzelnen Vokale im Gedicht zueinander – habe ich mich über Jahre intensiv beschäftigt.
Das ist sicher die eine, die sprachliche Seite. Thomas Bernhard etwa wird ja ebenso gerne als „musikalischer“ Autor bezeichnet mit seinen zyklisch sich vorwärts grabenden Endlossätzen...
(unterbricht) Nee. Bernhard kann nichts. Ein Phrasendrescher ohne viel Talent, wenn Sie mich fragen. Einmal angeworfen, rattert der sein Repertoire runter. Er ist halt nicht Céline! Céline ist ein Krakeeler von Gottes Gnaden – Bernhard ein österreichischer Provinzautor, der sich Zeit seines Lebens als Verfolgter eines von Altnazis regierten Staates dargestellt hat. Dabei war er einer der von ebenjenem Staat am meisten geförderten und unterstützten Schriftsteller.
Jedenfalls spielt die Musik im Rahmen Ihrer Romane nicht selten auch als Topos eine tragende Rolle. Zuvörderst in „Der große Bagarozy“, der aus der Sicht des Pudels von Maria Callas erzählt ist, sowie ihrem ersten größeren Erfolg „Melodien“.
Na ja, gut. Weil ich mich eben sehr viel mit Musik beschäftige, liegt es nahe, dass auch meine Plots musikalische Elemente enthalten. Allerdings war das in beiden genannten Fällen nie so geplant.
Bei „Melodien“ auch nicht? Das gesamte Buch ist doch letztlich eine historische, brillant imaginierte Schnitzeljagd nach der „Vox Dei“, der göttlichen Melodie – quer durch mehrere Jahrhunderte.
Selbst das hat sich erst während des Entwurfs herauskristallisiert. Ich war damals sehr konzentriert in Sachen Mythen-Forschung unterwegs und benötigte einen Stoff, anhand dessen man die Generierung eines Mythos über 400 Jahre nachzeichnen konnte. Das hätte also nicht zwingend mit Musik zu tun haben müssen. Allerdings lag es dann doch nahe: Die Musik ist ein ständiges, ununterbrochenes Band, ihre Entwicklung verläuft stringent, linear; anders als die Literatur, die mal an einen direkten Vorgänger anknüpft und dann wieder über 100 Jahre zurück springt. Und was den „Bagarozy“ angeht, da habe ich in der Münchner Abendzeitung ein Foto der Callas gesehen mit einem weißen und einem schwarzen Pudel im Arm – und, bumm: binnen 20 Sekunden war die gesamte Story da.
Was bei „Melodien“ so ziemlich das Gegenteil gewesen sein dürfte. Sie haben diesen faszinierenden 800-Seiten-Wälzer, der proppevoll ist mit kunsthistorischen Fakten und Anekdoten, geschrieben, da waren Sie gerade mal Ende 20. Wie macht man sowas?
Indem man dran bleibt. Vielleicht war ich zu jung. Ich besaß die Energie, um so was zu schreiben, aber ehrlich gesagt finde ich nicht, dass das mein bestes Buch ist. Ich würde „Melodien“ heute ganz anders machen.
Wie denn?
Kürzer. Für denselben Stoff würde ich heute um die 300 Seiten weniger benötigen. Man begeht in dem Alter als Autor einfach Fehler, die man mit etwas mehr Erfahrung umgehen würde. Man muss nicht mit allem, was man hat, protzen. Jetzt mit 40 fällt mir dieser Makel auch verstärkt bei anderen auf. Aber ich war genauso damals.
Ihre Kenntnis der italienischen Geschichte scheint jedenfalls enorm – oder ist da vieles Blenderei?
Nein, das nicht. Nichts davon ist erfunden, beziehungsweise: Es ist lediglich das erfunden, was sich nicht belegen lässt. Man sollte ganz einfach nicht unterschätzen, was man so alles aufschnappt, wenn man über einen längeren Zeitraum zwei Stunden täglich in irgendwelchen Büchereien zubringt. Da haben Sie binnen eines halben Jahres – egal zu welchem Thema – einen riesigen Fakten-Berg zusammen. Und den kann man sich dann schon zurecht zupfen. So wild ist das als Rechercheleistung nun wirklich nicht.
Ist „Melodien“ eigentlich Ihr kommerziell erfolgreichstes Buch?
Nein, am besten verkauft hat sich erstaunlicherweise die „Schmerznovelle“. Die Leute mutmaßen immer, das hinge mit dem teils recht derben, pornografischen, von vielen sogar als sexistisch empfundenen Plot zusammen, was ich aber nicht glaube. Der ist ja eher abstoßend.
Es wurmt Sie also, wenn man Sie als „Macho-Autoren“ bezeichnet oder Ihnen sexistische Züge vorwirft?
Schon ein bisschen. Weil ich an mir selbst überhaupt keine Macho-Züge entdecken kann. Ich bin niemand, der Frauen gegenüber eine wie auch immer geartete erhabene Position einnehmen würde. Gut: Ich nehme kein Blatt vor den Mund und verstelle mich nicht. Ich bin nun eben mal männlich geboren, daher sehe ich keinen Sinn, mir irgendwelche heuchlerischen Verständnis-Masken aufzusetzen. Ich habe mich aber auch verändert: Am Anfang meiner Laufbahn sind die Texte sicher unter anderen Hormon- Bedingungen entstanden. Einiges davon würde ich heute sicher dezenter behandeln.
Sie werden gleichwohl zugeben, dass einige Ihrer Protagonisten – Alban Täubner aus „Melodien“ etwa – dem weiblichen Geschlecht gegenüber eine recht extreme Haltung einnehmen. Da ist entweder krankhafte, bedingungslose Liebe bis hin zur Verfallenheit, oder eine seltsame Art der Verachtung.
Mag sein, nur dient das eben oft der Geschichte und hat mit mir nichts zu tun. Ich bin nicht sehr gut im Erotisch-Schreiben. Deshalb trifft ja auch der Pornographie- Vorwurf nicht: Bei mir gab und gibt es Erotik immer nur in einer bizarren, perversen Form, die sozusagen den Leser niemals zum Höhepunkt kommen läßt, sondern meistens kurz davor in frustrierender Form abbricht. Manche von meinen Helden sind sexuell ziemlich frustriert. Warum? Weil ich glaube, dass sexuelle Frustration ein Hauptantrieb in dieser Gesellschaft ist, für vieles Böse.
Und sie sind fast immer Außenseiter, die selten wirklich sympathisch wirken.
Von Iris Radisch stammt die Forderung, sie möchte am liebsten Romane lesen, in denen es um Familienväter mit vier Kindern geht. Aber, verdammt: Ich weiß schon, warum ich kein Kind gezeugt habe – und ich will ebenso wenig über eines schreiben. Mich interessiert dieser Alltagskram einfach nicht! Ich bin interessiert an Sonderlingen, an kauzigen Figuren, Ausnahmemenschen.
Man könnte noch einen Schritt weitergehen und behaupten: am Derben, am Verfall.
Absolut. Das ist ein Faszinosum, das mich schon immer begleitet. Das Abgründige, das Verwesende finden Sie bei mir überall. Aber immer im Kontrast mit dem Schönen. „UC“ spielt eher deshalb in Lazio, weil das dort stattfindende Abgründige sehr gut mit der pittoresken Landschaft kontrastiert. Wäre ich ein Filmemacher, ich wählte womöglich eine ähnliche Bildersprache wie David Lynch. Der Abgrund der sich hinter der Alltagsfassade auftut – derlei Dinge faszinieren mich ungemein. (überlegt) Wissen Sie, eigentlich war „Mulholland Drive“ eine ungewollte Adaption einer frühen Form von „UC“. Ich musste nach dem Film meinen Roman noch mal umschreiben, um da noch was Neues draufzusetzen.
Woher könnte diese Nähe zu Radikalität und Düsternis rühren?
Das Meiste davon ist wohl das, was ich selber nicht sein kann. Oder will. Ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Inzwischen jedenfalls. Nehmen Sie Konrad Johanser aus dem „Thanatos“: eine düstere, pessimistische Lusche, die meinem Wesen beinahe diametral gegenüber steht. Ich bin ja lebenslustig. Beim Thanatos bekam ich echte Depressionen. Fürchterlich, die ließen mich jahrelang nicht mehr in Ruhe.
Gleichwohl lässt sich auch bei Ihnen als Privatmensch zumindest ein gewisser Hang zum Extrem beobachten...
...das stimmt gar nicht! Ich versuche, all jene Geschichten von damals hinter mir zu lassen. Ich kann doch nichts dafür, dass in jedem Klappentext steht, dass ich mit 20 mal eine gewisse Zeit auf der Straße gelebt und obskure Berufe bekleidet habe. Naja gut, ich hätte mich dagegen wehren können, aber es war mir nicht wichtig. Glauben Sie mir: Ich führe ein recht langweiliges Leben! Trotzdem wollte mich Beckmann noch kürzlich nicht als Schriftsteller einladen – sondern als einen, der es aus der Gosse nach oben geschafft hat. Das ist völliger Quatsch. Für mich war dieses halbe Jahr auf der Straße ein romantisches Abenteuer, mehr nicht. Wenn man von radikalen Künstlern reden will, dann nehme man bitte jemanden wie Werner Herzog mit seinem „Fitzcarraldo“, der ein Schiff über einen Berg schleppt. Dagegen habe ich überhaupt nichts Ähnliches vorzuweisen und auch gar keinen Ehrgeiz in dieser Richtung. Ich führe ein relativ beschauliches, betuliches, ruhiges und möglichst sicheres Leben – für mich ist schon ein Schnupfen eine Katastrophe. (lacht)
Immerhin sollen Sie mal in einer einzigen Nacht 12.000 D-Mark verzockt haben, wenn die Geschichte stimmt – mithin Ihr komplettes erstes Literatur-Stipendium.
Die stimmt, allerdings waren es bloß 6.000 Mark, also die Hälfte des Stipendiums. Bei einem Griechen am Roulette-Tisch. Das werde ich nie vergessen. Ich bin um fünf Uhr morgens da raus gegangen und dachte: „Ah...Tragik! Echte Tragik!“ Für mich war das viel Geld, doch das Gefühl war groß. Und man konnte sofort drüber schreiben.
Thematisch operieren Sie am liebsten, wie Sie selbst einmal anmerkten, mit „archaischen Größen“: elementaren Konstrukten wie Liebe, Mythos oder Tod. In „Melodien“ ist es die Musik, im „Bagarozy“ – obschon ironisch gebrochen – der Teufel, im „Thanatos“ Johanser, der sich selbst mit dem Todestrieb identifiziert. Ihr vorletzter Roman „UC“ wiederum verlängert den Moment des Todes ins Absolute. Passt das überhaupt noch in unsere sich längst dem Fragmentarischen ergeben habende Zeit?
Warum denn nicht? Im Grunde ist sogar jeder Stoff auf diese drei Größen reduzierbar. Der Mythos als Überbegriff für die Lüge oder die Fantasie jeder Art – und Liebe und Tod als das, was uns alle tagtäglich am meisten berührt. Ich bin der festen Überzeugung, dass es ohne Sterblichkeit keine große Kunst gäbe. Sie entsteht erst aus dem Hass gegenüber dem Tod, aus dem Wunsch, sich über die Hintertür des Werks zumindest ein gewisses Bleiberecht zu erschleichen. Eine Illusion, natürlich. Aber als Antrieb hilfreich.
Was einem sowohl bei der Lektüre Ihrer „Tagebüchern“ als auch einiger Interviews auffällt, ist eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen Selbstbild und öffentlichem Status: Sie veröffentlichen mit ‚Rowohlt’ seit Jahren bei einem überaus renommierten Verlag, sehen sich selbst aber gerne als weithin unterschätzten Schriftsteller.
Na ja, gut...das ist schwer zu sagen. Da spielen nicht zuletzt die eigene Eitelkeit und das Ego eine große Rolle. Wenn Sie sich allerdings vor Augen führen, wie viele Nichtskönner absahnen, dann kann Ihnen schon mal schlecht werden. Nur: Im Endeffekt können die ja auch nichts dafür. Schuld ist unterm Strich das Publikum. Kritisch wird es, wenn ein Feuilleton nicht mehr fähig ist, mit Qualitätsparametern zu hantieren – und dem Publikum Dreck empfiehlt. Dann ist man gezwungen, Position zu beziehen. Ich weiß, es gibt zahlreiche Kollegen, die das verweigern und lieber keine Kritik an Ihresgleichen üben. Das ist zwar nachvollziehbar, aber auch ein bisschen feige. Man muss schon manchmal schimpfen dürfen, finde ich.
Unter dem Vorbehalt, dass auch Sie sich irren können.
Natürlich. Das Recht behalte ich mir vor. Zumal, wie gesagt, eine Autorin wie Judith Herrmann auch nichts dafür kann, dass sie pro Buch eine halbe Million Exemplare verkauft. Sowas ist mir zwar unverständlich, aber es ist eben so. Schlimm finde ich, dass man ihr den Kleist-Preis anträgt – und sie ihn tatsächlich annimmt! Das geht dann zu weit und erfordert einen Kommentar. (überlegt) Vielleicht setze ich einfach zuviel voraus bei meinen Lesern.
Wie meinen Sie das?
Na, dieses ganze Gerede über PISA – das stimmt! Ein Bildungsstand, dass es die Sau graust. Ich fürchte, meine Art des Schreibens ist für ein solches Publikum schlicht zu ambitioniert. Dabei bin ich selbst ja der Meinung, dass große Kunst zwingend große Unterhaltung zu sein hat. 90% Unterhaltung, höchstens 10% Belehrung, durch die Hintertür. Leider darf heute gar nichts mehr Mühe machen. Sogar an mir selbst stelle ich diese Faulheit inzwischen fest. Auch ich möchte als Leser auf einer sanften Welle getragen werden.
Empfinden Sie es demnach als Manko, wenn ein nicht geringer Teil Ihrer Leserschaft die „Melodien“ als historischen Abenteuerroman im Sinne Umberto Ecos versteht?
Nein, warum denn? Das ist ja auch einer! Unter anderem. Umberto Eco schätze ich durchaus, ein wunderbarer Trivialschriftsteller. Das meine ich nicht so abwertend. Ein gebildeter Mann. Er hat nur eben keine eigene Sprache, er bedient sich je nach Art des Plots der Sprachmuster anderer Autoren. Der Name der Rose war spannend. Das „Focaultsche Pendel“ hat sogar richtig tolle Stellen. Problematisch ist: Ich verkaufe ein paar Tausend meiner Bücher – Eco ein paar Millionen. Es fällt mir schwer, so einen per se zu mögen.
Ist Ihnen Wohlstand so wichtig als Antrieb?
Der Knackpunkt ist, dass ich im Grunde ein Spießbürger bin. Das heißt, ich habe ein extremes Sicherheitsbedürfnis. So lange ich vom Schreiben einigermaßen leben kann, bin ich mit den Bedingungen einverstanden. Bin ich allerdings tatsächlich gezwungen, meinen Lebensstil zu ändern, weil die Gelder mal nicht fließen, bekomme ich sehr leicht Panik und neige zu entsprechenden Reaktionen wie eben Ungerechtigkeiten gegenüber Besserverdienenden.
Aber Sie haben doch ein recht komfortables Auskommen. Davon können andere Kollegen nur träumen.
Lange vorbei. Richtig gut leben konnte ich lediglich von den zwei Verfilmungen des „Bagarozy“ sowie von „Fette Welt“...
...die Sie beide für misslungen halten.
„Bagarozy“ mit Till Schweiger war ziemlich schwach – wenn auch nicht gar so grausig wie „Fette Welt“. Etwas Schlimmeres ist mir als Autor nie widerfahren. Wenn man aus einer Vorlage, die ein deutsches „Pulp Fiction“ hätte sein können, ein pseudopoetisches, sozialdemokratisches Trauerspiel macht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Und der Hauptdarsteller, Jürgen Vogel, war ja toll. Daran lags nicht.
In diesem Zusammenhang fällt mir noch ein Zitat von Ihnen ein: „Ich bin überzeugt, dass, wäre ich ein Ami, ‚Der große Bagarozy’ zum Beispiel sofort ein Welterfolg würde mit einer oder zwei Millionen verkauften Büchern.“
Dazu fehlt es in Deutschland schon an Vertriebssystemen, am nötigen Wissen um Produktwerbung. Eigentlich an allem. Das führt bis dahin, dass die Deutschen den Zweiten Weltkrieg verloren haben. Das muss man einfach so sagen.
Sie rekurrieren auf die Scheu der Deutschen vor dem Erzählen? Vor offenkundig unterhaltender Literatur?
Nein, das ist gar nicht so der Fall. Wir sind ein viel kleineres Land als die USA, die sich als führende literarische Nation empfinden und ihre Erzeugnisse dementsprechend auch mit aller Macht verbreiten. Deutsche Literatur hingegen gilt im Ausland als Aussatz. Wenn in den Staaten von deutscher Literatur die Rede ist, dann bedeutet das im Höchstfall Ingeborg Bachmann, Handke oder Grass. Zwanzig Jahre später lesen die jetzt eine Jelinek und sagen: „Es hat sich überhaupt nichts geändert.“ Nicht ganz zu Unrecht, finde ich.
Wer trägt daran Ihrer Meinung nach die Hauptschuld? Das deutsche Feuilleton?
Alles, was bei uns auch nur eine Handbreit über den selbstverordneten Tellerrand hinausguckt, wird gnadenlos zurechtgestutzt. Vor allem aber fehlt es diesen Betonköpfen völlig an einem Bewusstsein für eine historische Kontinuität der eigenen Ignoranz. Für jede Ära gilt dasselbe: Das Feuilleton irrt sich in 90% der Fälle, und was die einen loben, das müssen die anderen wieder kaputt treten. Deutschland ist einfach ein Land voller Neid und Missgunst. Man kann sich ja auch auf nichts einigen und gegenüber dem Ausland selbstbewusst auftreten.
Auf was sollte man sich denn einigen? Auf allgemeingültige Qualitätsparameter? Auf einen Kanon gar?
Aber den haben wir doch schon! Und jetzt müssen wir leider 30 Jahre warten bis sich dieser bescheuerte Reich-Ranicki-Kanon biologisch abgebaut hat. Es ist furchtbar. (überlegt) Natürlich darf es keinen Kanon geben, das wäre ja Staatsliteratur. Aber es kann einfach nicht sein, dass ich eine komplette und sehr gelungene Übersetzung von „Melodien“ vorliegen habe – und kein britischer Verlag zu finden ist, der das haben will! Zu lang, zu deutsch. Deutsche zeitgenössische Literatur nach England zu lizensieren, das ist ungefähr, als wolle man einen syrischen Gedichtband an den Mann bringen. Mal abgesehen von Bestsellern wie Ingo Schulze oder Judith Herrmann. Kein Wunder, dass das Kopfschütteln im Ausland weiter anhält.
Das heißt, die deutsche Gegenwartsliteratur ist besser als ihr Ruf?
Ich kann reinen Gewissens sagen, dass ich in keiner anderen Epoche so viele gute deutsche Romane gelesen habe wie in den letzten 20 Jahren. Das geht von Thomas Hettches „Arbogast“ bis hin zu Moers’ „Rumo“. Oder nehmen Sie Daniel Kehlmann – den halte ich für besser als mich, und der ist zwölf Jahre jünger. Ein echtes Genie. Lesen Sie mal „Mahlers Zeit“, seinen besten Roman!
Wie ist es Ihrer Meinung nach um die Lyrik, ein derzeit ebenso stiefmütterlich behandeltes Terrain, bestellt?
Es wird heute nur deshalb so wenig Lyrik gelesen, weil sie so schlecht ist. Es laufen überall beschissene Lyriker rum – was da unter Lyrik firmiert und gefördert wird, ist einfach nur noch Gepopel und Geraune, Scrabblespiele mit der Sprache. Das Aufbrechen der Knochen. Das Herausschlürfen des Marks mit gleichzeitigem Wiederauskotzen. Das soll Kunst sein? Nein, danke. Reimen aber sollten wirklich nur sehr, sehr gute Lyriker. (überlegt) Wissen Sie, wenn ich mir über einen mir bis dato unbekannten Autoren ein Bild machen will, dann greife ich immer zuerst zu einem Gedichtband. Da trennt sich in der Regel die Spreu vom Weizen. Ich verweise hier nochmal auf Thomas Bernhard: Es sind kaum jemals beschissenere Gedichte verfasst worden.
Gerade Ihr Werk zieht ja ebenfalls nicht bloß positive Kritiken nach sich, sondern polarisiert im besten Sinne.
Stört Sie das? Aber nein, im Gegenteil! Als Autor muss man sich irgendwann entscheiden, ob man etwas schafft, das alle bloß ganz okay finden, oder ob man eine Kunst macht, die die einen lieben und die andern hassen. Darum geht es – selbst wenn mich manche Kritiken nachweislich ziemlich viel Geld gekostet haben; etwa der Totalverriss zum „Thanatos“ im ‚Spiegel’, über drei Seiten hinweg, das Bescheuertste und Niederträchtigste, was sich je ein Depp ausgedacht hat. Es gab eine Zeit, da hat mich jede negative Besprechung getroffen wie ein Peitschenschlag, doch das ist zum Glück vorbei. Irgendwann merkt man, es ist völlig egal. Man hat die Leser, die man wollte, und die bleiben bei einem.
Wann genau ging es denn damals eigentlich los bei Ihnen mit der Schriftstellerei?
Mit 16. Ich musste nachmittags viel lernen, da meine Schulnoten zu wünschen übrig ließen. Jeden Tag zwischen 14 und 18 Uhr verbrachte ich am Schreibtisch, und da ich nur sehr begrenzt Lust auf Hausaufgaben verspürte, schrieb ich heimlich Geschichten auf Karo-Papier auf. Das begann wirklich geradezu partisanenhaft. Immer Mittwochabend, wenn meine Eltern zum Tanzen aus waren, tippte ich auf meiner Schreibmaschine alles ab, was ich bis dahin zusammen getragen hatte. Am nächsten Morgen gab ich die Seiten dann meinem besten Freund Bernhard.
Sie meinen, er war Ihr erster Testleser?
Nein, der hat das Zeug für mich aufbewahrt. Bei mir wurde regelmäßig die Bude durchsucht. Und wenn irgendetwas gefunden wurde, das nichts mit der Schule zu tun hatte, wurde das sofort konfisziert und vernichtet.
Das hört sich nach einem eher problematischen Verhältnis an. Sind Sie in einem strengen Elternhaus aufgewachsen?
Es war die Hölle. Punkt Mitternacht an meinem 18. Geburtstag bin ich abgehauen. Reden wir lieber weiter über Literatur.
Auch gut. Gibt es Perfektion?
In einem Roman nicht, nein. Nie. Manchmal gibt es Perfektion in der Lyrik. Aber auch das ist sehr selten.
Was also lässt Sie weiterschreiben?
Da sind wir bei einem heiklen Thema angelangt. Ich habe nicht umsonst kürzlich meinen Rücktritt angekündigt; das meine ich schon ernst.
Sie meinen, Sie wollen ganz aufhören?!
Warum nicht? Ich muss mir langsam mal wieder ein anderes Betätigungsfeld suchen, weil ich glaube, dass ich dieses hier schlicht ausgereizt habe. Okay, Lyrik werde ich wohl immer schreiben; das kann man nicht einfach so lassen. Zumal darin auch mein größtes Talent liegt, wie ich finde. Ansonsten habe ich eigentlich alles geschafft, was ich mir vor zwölf, dreizehn Jahren vorgenommen hatte. Ich habe schon immer Autoren verehrt, die irgendwann zu einem Ende gefunden haben. Koeppen zum Beispiel. Oder Rimbaud. Bukowski hat immerhin mal zehn Jahre ausgesetzt, ebenso wie Rilke. Wenn ich meine Vorbilder betrachte – Celine, Fante oder Hamsun etwa –, dann kann man sehen, dass die Leistungskurve dieser Leute in der Regel zwischen dem 25. und dem 45. Lebensjahr ihre Klimax hatte. Nicht, dass Sie mich missverstehen: Ich sage nicht, dass ich nie wieder einen Stift in die Hand nehme, nur um ein falsches Comeback vorzubereiten. Ich will aufhören. Ob ich das schaffe, weiß ich selbst nicht.
Sie sind aber keiner der Autoren, für den der Prozess des Schreibens eine Qual, Entsagung darstellt?
Quatsch, überhaupt nicht. Wer Schreiben als Qual empfindet, der soll halt was anderes machen. Nein, ich rechne einfach damit, demnächst schwächer zu werden und möchte nicht ehemaligen Qualitätsstandards hinterher hecheln.
„Die wilden Hunde von Pompeii“war demnach tatsächlich ihr letzter Roman?
Nicht ganz. Es gibt noch zwei Prosa-Bücher, die bereits geschrieben sind und definitiv erscheinen werden: zum einen das „Eros“-Projekt und Gegenstück zum „Thanatos“, an dem ich 1996/97 scheiterte und das ich jetzt in anderer Form noch einmal angegangen bin, zum anderen eine groteske Erzählung. Meine Leser werden also nicht völlig krass entwöhnt. (lacht)
Was wäre denn eine Alternative? Sie sind ja gerade mal 40, was zu früh sein dürfte für den Ruhestand.
Ach, ich kann alles Mögliche machen, mal sehen. Ich könnte zum Beispiel als Münzexperte arbeiten. Am liebsten allerdings schriebe ich eine Oper. Wenn mir irgendeiner dieser verrückten Ölmagnaten da draußen ein bisschen Kohle zur Verfügung stellt, eine Art Apanage, damit ich zwei Jahre ungestört arbeiten kann, lege ich auf der Stelle los. (lacht) Warum gibt es das nicht mehr?
„Die Repopularisierung der Oper: Wenn Moritz und ich es nicht schaffen, dann niemand. Bessere als wir müssen erst noch geboren werden. Dazu wird verdammt viel Rumgeficke nötig sein. Verdammt viel.“ Das klingt nicht bloß latent größenwahnsinnig, sondern auch sehr viel emotionaler, Das muss man im richtigen Kontext sehen: Damals drohte die Biennale gestrichen zu werden, und ich war voller Zorn. Dafür, dass man solche emotionalen Ausbrüche aufschreibt, ist ein Tagebuch ja da. Man sollte nie den Fehler begehen, so was nachträglich abzumildern auf Kosten der Wahrhaftigkeit.
Ihr aktuelles Buch, „Die wilden Hunde von Pompeii“, hat selbst einige Ihrer größten Fans vor den Kopf gestoßen. Die ‚KulturNews’ bezeichnete Ihre Fabel als „Fantasy-Roman im Doggy-Style“.
Inzwischen gab es ein paar sehr schöne Rezensionen, wenn auch bis auf die SZ nicht an prominenter Stelle. Es scheint mir, ein Buch mit Hunden und Zeichnungen darin wird von vornherein nicht ganz ernstgenommen.
“In der Tat kommt das Buch für Ihre Verhältnisse enorm leicht, fast simpel daher, was Tonfall und Plot angeht.
(abwertend) Ahh...überhaupt nicht! Vielleicht die ersten 20 Seiten. Die stammen noch aus der Zeit, als das Ganze eher für Kinder geschrieben war. Gerade der Mittelteil gehört zum Besten, was ich je gemacht habe. Ich bin inzwischen wirklich sehr zufrieden damit, auch wenn ich manchmal schier daran verzweifelt bin. Wenn Sie mich fragen, mein originellstes Buch.
Aber genau das wird Ihnen ja angekreidet: Das Buch sei ein Zwitter – zu kompliziert für eine Parabel, zu banal für einen ernstzunehmenden Roman.
Schauen Sie, so ist das mit Idioten! Die fragen immer zuerst „Was soll das?“, als dass sie sich freudig an den Gedanken gewöhnen, hier läge vielleicht etwas Neues vor. Ich war mir bereits im Vorfeld sehr wohl bewusst, dass das ein Flop werden könnte. Eben genau deshalb, weil ich ganz bewusst Gesetzmäßigkeiten des Genres unterlaufe: Es gibt Schlüpfrigkeiten sexueller Art als auch Gewalt mit Folgen. Selbst gegenüber völlig Unschuldigen. Sogar eine Euthanasie-Debatte gibt es. Ich gaukle dem jugendlichen Leser keine heile Welt vor. Ich zumindest hätte mir solch ein Buch gewünscht als Kind. Wollen Sie wissen, was meine Lieblingslektüre als Neunjähriger war, neben „Oliver Twist“ oder „Gulliver“? Die 24 Bände der Nürnberger Prozesse!
Kann man sagen, dass gerade der permanente Grenzgang zwischen leichtverdaulicher Literatur und hochkomplexen, streitbaren Gedankengebäuden Sie per se angreifbar macht? Das ist ja ein Zwiespalt, der Ihr gesamtes Werk bestimmt – und den Sie diesmal nur auf die Spitze getrieben haben.
Absolut. Ich würde meine Literatur mit Mahlers Sinfonien vergleichen – eine historische Analogie, die mir passend scheint. Seine Sinfonien waren komplexe, gewöhnungsbedürftige Mixturen, deren Tiefe erst auszuloten war und die vor manchem Effekt nicht zurückschreckten, die populär sein wollten, aber nicht zu populär. Und die lange als ekklektizistisch, morbide und sogar banal galten. Wahrscheinlich werde ich wie er eines Tages relativ unberühmt sterben, doch meine Bücher werden mich überleben. Da bin ich mir sicher. Das hab ich so gewollt, ein Autor für wenige, dafür ein bisschen länger.
Stört es Sie eigentlich, wenn man Ihnen – nicht nur in diesem Zusammenhang – latenten Größenwahn vorwirft?
Natürlich nicht! Ich bin ja größenwahnsinnig! Absolut. Anders entsteht keine große Kunst: Erst kommt der Größenwahn – dann die Größe. Alles sonst ist Kleinmut. Natürlich kann man auch einfach nur kläglich scheitern. Dann ist es auch egal. Bis jetzt bin ich aber nicht wirklich gescheitert; jedenfalls nicht vor mir selbst. Wenn ich mir alle meine Bücher anschaue, wie sie da so auf meinem Schreibtisch nebeneinander stehen, dann bin ich schon bass erstaunt, was sich da so angesammelt hat. Das ist viel – und das ist vielleicht auch ein bisschen groß.
Sie haben nicht bloß Shakespeares „Tragödie vom Leben und Sterben des Julius Cäsar“ neu übersetzt, sondern außerdem den aberwitzigen Versuch unternommen, die Nibelungen“ neu zu dramatisieren.
Tja, ich war nur leider ein bisschen zu spät dran. Als ich fertig war, hatte Rinke den Stoff schon durchs Rohr gejagt. Insgesamt brauchte ich zehn Jahre. Als ich 1992 begonnen habe, galt der „Nibelungen“-Stoff als politisch absolut fragwürdig, wurde von den historischen Ereignissen in die Ecke der Deutschtümelei gedrängt. Ich dagegen war schon immer der Meinung, dass das im Grunde ein überaus raffinierter, ganz europäischer Plot ist, der viel eher etwas mit Sachen wie „Der Pate“ gemein hat. Ich dachte, das müsse man nur mal angemessen aktualisieren – das ganze Pathos irgendwie beibehalten, ohne dass es gleich aufgebläht und nationalistisch wirkt. Was Pathos anbelangt, haben wir Deutsche ja noch immer einen selbst auferlegten Keuschheitsgürtel um, der einen als Künstler teilweise echt kastriert. Gehen Sie mal in einen asiatischen Martial-Arts-Film wie „The Hero“ oder „Tiger And Dragon“ und schauen Sie, wie pathetisch das ist! Wenn Sie Ähnliches als Deutscher versuchen, hagelt es sofort SS-Vergleiche.
Was ist mit Ihrer Bewunderung für Ernst Jünger, mit dem Sie bis zu seinem Tode in regem Briefkontakt standen – ebenfalls ein prominenter Vertreter der Tagebuch-Form?
(wehrt ab) Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet mir das angekreidet wird, wo einer wie Heiner Müller doch noch viel faszinierter war von Jünger. Ich habe immer wieder betont, dass ich mit Jünger politisch nichts am Hut habe, seine metaphysische Tiefe aber ungemein bewundere. Jüngers Größenwahn kann sehr anziehend sein in seinem Willen, den Kosmos metaphorisch zu umarmen. Andererseits war er ein fürchterlicher Romancier. Die sinnliche, kühle Präzision seiner Tagebücher, die fasziniert mich, ja. Das ist wie ein Widerglanz der Antike und ihres Totalitätsanspruches auf Wissen. Nicht zu vergessen: sein bis zuletzt unkorrumpiertes Leben. Jünger war gewissermaßen unbeugsam.
Und unbelehrbar.
Nein, da irren Sie. Jünger hat sehr wohl über sich nachgedacht, nur neigte er nicht zur öffentlichen Selbstkritik. Aber wie gesagt: Der politische Jünger ist auch mir höchst suspekt. Ein Buch wie der „Arbeiter“, diese seltsame rot-braune Mischung ist mir stets unverdaulich geblieben.
Auch im Zusammenhang mit „Thanatos“ ist Ihnen wiederholt Deutschtümelei vorgeworfen worden, und rein sprachlich gibt es Kollegen, die Sie einen „Kraftkerl“ schimpfen.
Ach, Gott... ja, vielleicht bin ich etwas grob manchmal. Den Hang zur ständigen Verfeinerung überlasse ich anderen. Aber was den „Thanatos“ anbelangt: völlig absurd. Das ist ja ein hochironisches Buch. Der Kauz Johanser weigert sich, Anglizismen zu verwenden, das finde ich persönlich lächerlich. Ich habe langsam eher das Gefühl, gewisse Leute wollen mich missverstehen...
...was zugegebenermaßen nicht allzu schwer fällt: „Wer mich einen Kommerz-Schriftsteller nennt, muss einen an der Waffel haben. Elitäreres als meine Bücher gibt es nicht.“ Was genau bedeutet Ihnen dabei der Begriff der Elite?
Ich weiß, das Zitat ist nicht arg glücklich, weil „Elite“ in der Tat ein sehr schwammiger Begriff ist und es natürlich elitärere Bücher gibt, nur nicht in der Belletristik. Gleichwohl stehe ich dazu. Was den Kommerzschriftsteller betrifft: Wenn ich nur so viele Bücher verkaufen würde, dass dieser Vorwurf gerechtfertigt wäre!
November-„Tagebuch“, wo Sie Ihre Vorbilder und Einflüsse benennen, werden diese Eliten konkretisiert: "Deutschland. Das Romantisch-Spirituelle germanischer Eliten." Wenn es Ihnen, wie Sie behaupten, nicht um den Effekt, um die Lust an der Provokation geht – warum begeben Sie sich dann freiwillig auf derart vermintes Terrain?
Ein großes Missverständnis: Neben Deutschland nenne ich z.B. auch Amerika und das, was mich von dort her geprägt hat. Mit den germanischen Eliten ist gerade nichts Nationalistisches gemeint, sondern mein pädagogischer Stammbaum aus der deutschsprachigen Kultur, die Denker und Künstler einer elitären Weltsicht, sprich: die Linie Hölderlin – Hegel – Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger, demgegenüber in der Musik Beethoven – Schubert – Bruckner – Wagner – Mahler. Ich habe mit Nationalismus gar nichts am Hut.
Patrick Großmann
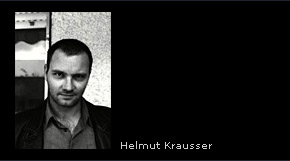
zuletzt aktualisiert im Februar 2026


