• Tonträger
• CD-Tipps & Beste Alben
• Besuchte Konzerte
• Video / DVD
• Links zu Bands
• ROLLING STONE: Musik News
• HELMUT KRAUSSER
- Aktuelles
- Lesungen / Termine
- Werkverzeichnis
- Wer hat uns je geliebt?
- ![]() Freundschaft
Freundschaft
und Vergeltung
- Trennungen, Verbrennungen
- Zur Wildnis:
45 Kurze aus Berlin
- Puccini Roman
- Einsamkeit + Sex + Mitleid
- Eros
- Portrait
- Interviews
- Leseproben
- Lyrik
- Tagebücher
- Deutschlandreisen
- Kraussers Lieblingsbücher
- Krausser & Klassische Musik
- Der Komponist Helmut
-
Krausser
• BIBLIOTHEK / BELLETRISTIK
• MUSIKBIBLIOTHEK
„Ruuuf den Notar, Thanatos“: Zu Helmut Krausser und seiner „Kartongeschichte“
Abstract: Helmut Krausser servierte seinen Lesern neben einem Tagebuchmarathon , Lyrikströmen und erotischen Herausgebereskapaden (Samuel Pepys Schriften) besonders als Prosaautor schon unter anderem den Literaturwissenschaftler als Todesgott, einen Bewusstseins-Rider, der seinem Schöpfer Helmut entgegentritt, Hunde in Pompeii oder den in Maria Callas verliebten Teufel Stanislaus. Nebenbei schlüpfte er in die Rolle des dramaturgischen Spielverderbers im 4. Akt von „Julius Cäsar“, ließ im „Diptychon“ eine Elke zerhacken und schrieb neben einem Destillat des Nibelungenliedes die wahrscheinlich erste Trash-Oper der deutschen Literaturgeschichte. Nach „Eros“ erschien Anfang 2007 die „Kartongeschichte“, ein groteskes, vielleicht neben seinen großen Romanen etwas unterschätztes Werk des multitalentierten Autors, der – trotz eigener Ankündigung1 – nicht aufhören darf zu schreiben. Eine Annäherung über mehrere Stationen dieses Ausnahmeautors.
Krausser beginnt man besten mit Krausser:„Sekunden. Schnittstellen. In Feindschaft mit sich und seiner Umgebung, aufgebahrt in Bitternis, nur selten von mildtätiger Gleichgültigkeit bedacht, zählte Johanser Sekunden. Zählte Sekunden. Zählte Sekunden, und wenn sechzig (60) zusammen waren, flocht er ihnen ein Bändchen um und schrieb Minute drauf, und wenn sechzig (60) Bändchen zusammen waren, legte er sie in einer Kiste namens Stunde ab, und wenn sich zwölf (12) Kisten vor ihm stapelten, weigerte er sich, sie als Tag anzuerkennen, rannte aus der enggewordenen Wohnung, hockte sich mit Wein an die Spree und soff, in der Böschung versteckt, bis die Nacht vorüber war.“2 So führt uns Krausser zu Konrad Johanser, Archivar des Instituts für Deutsche Romantik, dem Protagonisten eines der Romane, die Krausser zu einem der avanciertesten Autoren der jüngeren deutschen Literatur aufsteigen ließen. „Thanatos“ steht exemplarisch für Kraussers kreatives Schöpfen aus einem breiten, oftmals multimedial angelegten Spektrum der Kulturgeschichte (Paradebeispiel: sein opus magnum „Melodien“), sowie seinem Faible für mythische bis mythologische Stoffe des Verfalls, die er in zeitgenössische Geschichten übersetzt und zu spannenden Plots ausnutzt, phasenweise geradezu im wahrsten Sinne des Wortes ausreizt. Der lange Weg des Literaturfälschers Johanser in die persönliche Liebestragödie mit der Kellnerin Anna und dem offenen Konflikt mit seinem Cousin Benedikt wurde nicht nur vom Autor selbst als dessen bedeutendster Roman geadelt, der sich neben Johansers Beruf oder einem dem Roman symptomatisch vorangestellten Novalis-Zitat aus „Heinrich von Ofterdingen“ („Wo gehen wir denn hin? Immer nach Hause“) zu seinen romantischen Referenzen mehr als nur offen bekennt. Was früher aus Eichendorffs Florio(„Das Marmorbild“) oder Hoffmanns Traugott („Der Artushof“) als „Gesinnung, Tun und Treiben“3 aus dem Innern heraustritt, setzt sich in Konrad Johanser fort, wenn sich dieser „suchte sich vorzustellen, welch zauberhafte Rätsel einmal in lunare Krater hineinphantasiert werden konnten, bevor der Erdtrabant seiner leblosen Staubkälte überführt worden war.“4 Ein Schritt durch den Spiegel, in den sich, „bei längerer Betrachtung, halluzinierendes Dekor dem Bild beigemischt“5 hatte. Für Johanser, der nach seiner Tat aus Berlin „nach Hause“ und damit zu seinen Familienangehörigen flüchtet, bedeutet seine Liebe zu Anna (erwartungsgemäß) nicht das Ende seiner permanenten Existenzkrise, seinem Leiden am Nicht-Genie. Doch bei Krausser geht es nie „nur“ um Schaffen oder Nicht-Schaffen, sondern vielmehr die damit verbundenen, meist noch tiefer in seinen Figuren verwurzelten Exzesse, für die selbst Romantiker wie Hoffmann oder Wackenroder noch kaum Worte fanden. Krausser legt seinen Figuren genau solche in den Mund. Er belässt es nicht dabei, vom Unbewussten seiner Figuren zu erzählen, denn Krausser ist ein Sprachvirtuose, der – und dies erscheint für sein Werk im Besonderen zu gelten – das Sprechen und Denken über Sexualität als pervertierte Devianzerfahrung seiner Figuren expliziert, nicht erotisiert und schon gar nicht durch ein Schweigen seiner Figuren in der Imaginationsleistung des Lesers allein versteckt. Für „Thanatos“ stimmte er dazu traditionsbewusst besonders poetische Töne an, die das Leiden an der unvermeidbaren Unvereinbarkeit zwischen vergangener Kunst und der heutigen Welt umspannen. Einer Welt, die für Johanser, „im Ton der heutigen Welt abgefaßt“6 , nicht zu bewältigen ist. Der Ton, die Sprache stehen nicht in seiner Gewalt, weil er sie „nicht lieben kann.“7 So mündet die Poesie in der Tragödie, die Johanser ebenfalls nur in Poesie auszudrücken fähig ist:„Der geile Dämon ragt aus mir in Bettlerlumpen, wippt und sabbert, mit Glutaugen in halbvermoosten Höhlen. Der Feendschungel zwischen ihren Schenkeln soll meinen Kopf zusammenpressen, damit er nicht zerspringt. Nachts allein im Schamwald hausen, wo wäre sonst für mich Platz? Anna, ich will deine Fut als Narrenkappe tragen, deine Beine als Schulterstücke, deine Füße als Orden auf der Brust(...) Es wird September sein, und der Pferdekerl wird verrecken, in einer enormen Blutlache, wird mit beiden Händen das aus ihm flüchtende, in alle Richtungen fortfließende Blut zu halten suchen, mit Drohungen und Versprechungen. Und ich werde sagen: Einmal hast du gelebt wie Götter. Mehr bedarf´s nicht.“9 Damit konnte - trotz der vorhersehbar kontroversen Diskussion um dieses nur schwer zugängliche, jedoch sogar notwendigerweise sperrige Werk - Kraussers Wappen endgültig im Trophäenschrank der literarischen Champions League ausgestellt werden.
Was erwartet der Leser nun 8 Jahre Jahre später von einem Autor, der mit „Eros“ einen Roman vorlegte, der sich nicht ohne Mühe als glattes, von vornherein eindeutig ersichtliches Äquivalent zu seinem motivischen Bruder „Thanatos“ gesellen wollte? Die erzählten Lebenserinnerungen des Großökonom Alexander von Brücken, welche gelegentlich als Kraussers nicht vollständig gelungener Versuch eines Historienromans über das Ende des Dritten Reiches und der aufblühenden Bundesrepublik am Beispiel des Lebensweges seiner Hauptfigur und dessen obzessiver Liebe zur Arbeitertochter Sofie gedeutet wurden. Dabei lebt „Eros“ nicht von der plausiblen Aufbereitung historischer Entwicklungen innerhalb einer ungewöhnlichen Liebesgeschichte, sondern vielmehr von der Rahmenhandlung, die den Leser in ein fesselndes Taktierspiel zwischen dem (unzuverlässigen?) Erzähler von Brücken und dem von ihm angeheuerten literarischen Verwalter seiner biografischen Hinterlassenschaft verstrickt. „Eros“ mutiert, in konsequenter Art und Weise, zunehmend zu einem Roman über den Weg zu einem Verständnis der Lebensansichten des zuweilen in sich hinein schnurrenden Katers von Brücken, dessen Lebensbeichte und die damit unmittelbar verbundene Rezeption durch den misstrauischen Autor stets zwischen der Suche nach poetischer Authentizität und selektiver Verschleierung (beispielsweise was von Brückens Vater und dessen Verbindungen zum Nationalsozialismus angeht) changieren. Dieses spiegelbildliche Verhältnis zwischen Erzähler und Autor, Auftraggeber und Angestelltem, Wissendem und Unwissendem sorgt bis zum Ende für die faszinierendsten Spannungsmomente des Romans. „Eros“ ist gelesene Beobachtung, ist Dichtung und Wahrheit, das untrennbare Geflecht. Statt die Lektüre ganz auf historische Zäsuren wie die Bombardierungen während des Zweiten Weltkrieges oder das Aufkeimen der Bundesrepublik bis zu den Zeiten des RAF-Terrors auszurichten, beobachten wir vielmehr, wie der Biograf seinen Geldgeber von Brücken beobachtet, ihn zunehmend observiert. So, wie von Brücken zuvor Sofie. Dessen unstillbare Leidenschaft der Frau die er ausschließlich ökonomisch für sich gewinnen, nur situativ physisch nutzen und deren Anziehungskraft er sich dennoch nicht einmal in den Luftschutzkellern erwehren kann, stellt das Gerüst der Binnhandlung dar. So ist Krausser unter diesen Bedingungen speziell durch Sofies spätere Rolle als Lockvogel für eine geplante Entführung von Brückens das gelungen, woran manche Autoren womöglich gescheitert wären – eine spannende Binnenhandlung zu erzählen, die nicht nur als Fundament der Rahmung funktioniert und umgekehrt.
Wer sich kontinuierlich durch das Oeuvre des Thomas-Bernhard-Verächters Krausser („Bernhard kann nichts.“9) genossen hat, konnte – zumindest im Bereich Prosa – kaum noch Erwartungen haben. Zu sehr schien Krausser bereits seine motivischen Präferenzen ausgereizt (man vergesse in diesem Zusammenhang nicht seine Lyrik, die, wie bei anderen Dichtern, nicht zum unrhythmischen Etikettenschwindel mutiert, Kommentar Krausser:„Es wird heute nur deshalb so wenig Lyrik gelesen, weil sie so schlecht ist. Es laufen überall beschissene Lyriker rum.“10), seine an sich selbst gerichteten Erwartungen schon erfüllt zu haben.11 Noch einmal ein Stück italienischer Geschichte romancieren oder erneut eine Novelle kreieren, die von kleinkarierten oder besser: leicht zu schockierenden Lesern als Angriff auf die „schöne Literatur“ verschluckt werden könnte und neben „Jelinek, dem unbekannten Wesen aus einer perversen Welt“ in der Schmuddelecke politisch korrekter Gesellschaftsseismografen verrissen wird? Wohl nicht mit Helmut K., der seinen kreativen Abschied schon mehrfach einleitete, ehe er dann doch einmal der Versuchung unterliegen könnte, des lieben Geldes wegen über liebevolle Familien mit Kindern zu schreiben oder in deutschen TV-Shows als „Aufsteigerpoet“ verkitscht zu werden, dem seine (zugegebenermaßen herrlich amüsant überlieferten) „Jugendsünden“ - wie das Verzocken eines beträchtlichen Teils seines Münchner Literaturstipendiums - als notwendiger Weg zum Ruhm sozialromantisch geformt und entlockt werden sollen.12 Krausser hierzu in einem Interview:„Ich habe schon immer Autoren verehrt, die irgendwann zu einem Ende gefunden haben. Koeppen zum Beispiel. Oder Rimbaud. Bukowski hat immerhin mal zehn Jahre ausgesetzt, ebenso wie Rilke. Wenn ich meine Vorbilder betrachte – Celine, Fante oder Hamsun etwa -, dann kann man sehen, dass die Leistungskurve dieser Leute in der Regel zwischen dem 25. und dem 45. Lebensjahr ihre Klimax hatte.“13 Krausser rast auf diese Hürde zu, steht er also kurz vor dem poetischen Niedergang? Eine fast zu offensichtliche „Ironie des Schicksals“. Oder um ein Zitat aus Kraussers Spiegeldrama „Spät Weit Weg“ zu bemühen:„Die Wirklichkeit ist ein Pfad im Ozean der Träume.“14
2007 also die „Kartongeschichte“, in der neben zahlreichen anderen Kuriositäten ein Karton ans Meer reist, Fleisch in der Hose versteckt wird und auf Eris Papa Pilze „rost- und honigfarben“15 wachsen. Wenn man als ein Kriterium für gute Literatur die gesamtkonzeptionelle Funktionalität eines Motivs oder Titels innerhalb eines Textes benennen möchte, so präsentiert sich die „Kartongeschichte“ durch ihre inhaltlich wie narrativ grotesk verschachtelte Struktur als nahezu antipodisches Kontrastwerk zum Vorgänger „Eros“.
Der Klappentext dieses (so genannten) Romans voller unerhörter Begebenheiten weiß dann auch in gewohnt metaphorischer Anbiederung (Herausgeber sprechen wohl eher von einer „assoziativen Spannung“) an andere Medienformate von einem - wir erinnern uns - „Buch im Fast-Forward-Modus“ zu berichten, das für die Literatur das sein könnte (oder soll), was Jeunets „Die Fabelhafte Welt der Amélie“ für den Film ist. Abgesehen davon, dass sich Literatur längst des memorierenden Rückgriffs auf Filme bedienen muss, um in knappen Worten die Kauflust der potenziellen Leser zu aktivieren, legen uns nicht nur die Siren des Klappentextes eine intermedial fokussierte Perspektive nahe, sondern auch der Autor selbst. So eröffnet Krausser diese Erzählpartie mit einem Hauch Kinogeschichte, indem er uns an die Aufführungsdispositionen einer für uns längst vergangen, im Zeitalter der digitalen Mediendatenträger antiquierten Epoche der frühen Kinematheken erinnert:„Vor etwa hundert Jahren hätte an dieser Stelle der Erzähler im Stummfilmkino dem Mann (oder der Frau) am Klavier einen Wink gegeben. Mann (oder Frau) am Klavier hätten einen elegisch-melancholischen Akkord gespielt, B-moll 7 vielleicht, und auf der Leinwand wäre mit fett verzierter Schrift, umrahmt von einer Art Jugendstil-Trauerrand, das Wort Gewitter verkündet worden. So kann man das, wenn man kaum Geld für Special Effects übrig hat, immer noch machen. Das Publikum liest Gewitter – und weiß sofort Bescheid.“16 Abgesehen von der generell interessanten Frage, ob der natürlich so leider nie real existierende „Modellkinogänger“ nun mehr vom Wort oder dem Klang Gewitter emotionalisiert wird, ein anderer, wenn auch unmittelbar an diese Frage anschließender Aspekt dieses Vorwortes bedeutsam. Benötigt der Leser diese zusätzliche Emotionalisierung? Oder anders gefragt: Ist die emotionale Informationsleistung, die Musik in diesem Beispiel leistet, überhaupt nötig für die Emotionalisierung oder gar das Verständnis des Textes? Der letzte Satz des Zitats legt uns – zumindest optional - eine sowohl positive wie negative Lesart nahe, da im zweiten Teil dieses Vorwortes (inhaltlich markiert durch die direkt an den Leser adressierte Aufforderung, einen B-moll-7-Akkord zur persönlich Einstimmung anzustimmen) die emotionale Wirkung der nun folgenden Ereignisse eng an das Medium Musik gekoppelt werden („(...)bis hinauf zum dreigestrichenen F wie Fiasko“17), obwohl sich der Leser nach beendeter Lektüre fast hinters Licht geführt sehen muss. Denn die „Kartongeschichte“ ist groteske Komödie statt erzählter Mollakkord. Wenn man diese Eingangspointe einer solchen Lesart, nämlich das ein Text thematisiert, dass er bestimmte Erzählzusätze und Elemente (Braucht das Kino etwa heute noch einen realen Erzähler oder einen Klavierspieler?) nicht für seine narrative Qualität benötigt, ernst nimmt und mit der weiteren Erzählweise der „Kartongeschichte“ vergleicht, kann man ein für diese Erzählung besonders einschlägiges Charakteristikum der Krausser´schen Erzählkunst markieren – ein permanentes Vexierspiel innerhalb der Narrationsstruktur, die zwischen Information und Digression oszilliert und folglich konventionalisierte Lesererwartungen nicht nur permanent unterläuft, sondern diesen Prozess sogar explizit thematisiert. Beispiel gefällig? „Manche junge Menschen haben viel erlebt. Über Eris Jugend ist das Wichtigste erzählt. Daß sie ihren Vater zu mögen beschloß, nur weil er an Diabetes und Atemnot litt, könnte ausgeschmückt werden. Muß aber nicht.“18
Dieses Vorgehen zieht sich durch die gesamte Erzählung. Eri (die eigentlich Augusta heißt), eine verstockte und vor allem sexuell ziemlich zurückgebliebene junge Frau, lebt allein mit ihrem Vater bis dieser plötzlich verstirbt. Der Erzähler vermeidet jede Art von narrativem Überschuss und setzt den Vater bereits im ersten Satz schachmatt:„Regen trommelte aufs Dach der Penthousewohnung, als Eris Vater starb. Ruuuf den Notar, so seine letzten Worte, er richtete sich noch einmal auf, röchelte, preßte beide Hände auf sein Herz und verschied. Ruuuf den Notar. Mitten in der Nacht. Wozu hatte er einen Notar haben wollen? Als Eri dahinterkam, daß für das z und das t seinen Lippen keine Spannkraft geblieben war, lachte sie laut. Und schämte sich.“19 Eine radikalere Vermeidung jeder Emphase scheint kaum möglich, zumal der Tod des Vaters durch Eris vorübergehendes Unverständnis eine hochgradig groteske Eingangsszene darstellt, die bereits – Klappentexte lügen nicht – an den radikalen Tod der Mutter in „Die fabelhafte Welt der Amélie“ erinnert, was wir jedoch nicht weiter vertiefen wollen, obwohl dies ohne Weiteres möglich wäre. Wichtiger für die an dieser Stelle nur kurz angedeutete Überlegung ist eher die „Textsache“, dass Regen auf das Dach der Penthousewohnung trommelte. Erst Klavier und Gewitter, nun trommelnder Regen. Diese „semantische Kontinuität“ funktioniert auf mehreren Ebenen. Einerseits verbindet sie das Vorwort motivisch mit der eigentlichen Erzählung, andererseits fungiert sie in dieser Extremsituation ( Tod des Vaters) als völlig irrelevanter Einstieg, der durch seinen extrem konventionalisierten Charakter (Wie oft mag in der Literaturgeschichte schon Regen auf Dächer getrommelt haben?) das Geschehen fast karikiert. Ebenso bemerkenswert an dieser Passage: Der Tod des Vaters geht hier regelrecht performativ einher mit dem Verlust seiner Artikulationsfähigkeit. Sprachliche Kontingenz löst hier zwar einerseits eine gewisse Komik (für Eri) aus, doch abgesehen von der unmittelbar nachgeschobenen Erläuterung dieses Missverständnisses: Warum sollte ein sterbender Vater nicht nach einem Notar verlangen, zumal Eris finanzielle sowie familiäre Situation, wie wir im weiteren Verlauf der Handlung erfahren, alles andere als überschaubar ist und wir mit der Figur des Jonas eine Figur vorfinden, der sich neben dem Tod seiner Mutter noch mit deren Testament konfrontiert sieht. So wird Eri bereits mit wenig Aufwand zu einer Art Kontrastfigur zu Konrad Johanser und dessen Sprachkompetenz, die keine Komik zulässt. Und dennoch leiden beide, wenn auch fundamental voneinander abweichend, an der Sprache. Wenn Hugo von Hofmannsthal im „Chandos Brief“ seinen Lord darüber schreiben lässt, dass es diesem nicht mehr gelingt, die Dinge und ihre Bezeichnungen „mit dem vereinfachenden Blick der Gewohnheit zu erfassen“20, so verweist das Figurenensemble der „Kartongeschichte“ nicht nur auf der Handlungs-, sondern ebenso auf der Sprachebene des Textes genau auf jene grundlegende Lebensirritation, mit der besonders Eri zu kämpfen hat, die zu Beginn der „Kartongeschichte“ nicht einmal ein Telefon ihr Eigen nennen möchte und - im Gegensatz zu Konrad Johanser - nicht ein einziges Buch besitzt:„Ob er mich schwanger gemacht hat? Kaum, der Zeitpunkt lag günstig. Vielleicht sollte sie sich doch endlich ein Telefon anschaffen. Damit sie jemandem, irgendwann, ihre Nummer geben kann. Hätte der Typ gestern gesagt: Gib mir mal deine Nummer, ich ruf dich an, wäre es mir peinlich gewesen, zu antworten: Ich hab kein Telefon. Das hätte unhöflich geklungen, weil unglaubhaft, so als wolle man sagen: Danke, nein, ich will nicht, daß du anrufst. Aber der Typ hat nicht gefragt. Fand er mich nicht gut? Gut, daß er nicht gefragt hat.“21
Doch Krausser wäre nicht Krausser, wenn er die Klaviatur eines solchen Spiels nicht weiter ausreizen könnte. Die Gattungsfrage gewinnt mit zunehmender Textdauer an Dynamik, denn trotz der eindeutigen Klassifikation als Roman (Lügt also zumindest Seite 3?), verbirgt sich auch in dieser Frage offenbar ein Spiel des Autors mit der Lesererwartung. Fassen wir zunächst die wichtigsten Ereignisse rund um Eri und ihren toten Vater knapp zusammen: Eri arbeitet im Pornokino und verliebt sich kurzzeitig in den schwulen Stricher Angelo. Dann hat Eri endlich einmal Sex, lernt Liz kennen, die mal mit Stan liiert war, der wiederum den „einmaligen“ Sex mit Eri hatte und seiner Verflossenen nachstellt, weil er den Sex mit ihr vermisst. Liz zieht zu Eri und will ihr helfen, endlich die längst verfaulte Leiche ihres Vaters in einem Karton aus der Wohnung zu schaffen. Dieses Unternehmen wird unter anderem gerade deshalb aktuell, weil überraschenderweise Eris Mutter aufkreuzt, die sie nach der Geburt verlassen hat. Um die Leiche verschwinden zu lassen, brauchen Eri und Liz Jonas, der wiederum ein Verhältnis mit dem Stricher Angelo hat, in den Eri kurzzeitig verliebt war.... Wir könnten noch ein wenig so weiter verfahren, halten es aber erneut ganz mit dem Erzähler, der uns im 11. Kapitel, dem „Deleted Chapter“ folgenden metafiktionalen Einblick gewährt:„An dieser Stelle wurde ein Kapitel getilgt, um der Geschichte mehr Drive zu verleihen. Kilometerlang wird darin geschildert, wie Angelo nach einem tränenreichen Nervenzusammenbruch doch noch eine Nacht länger bleiben darf, wie Jonas zu dem Trio stößt, wie es eine zweite kleine Eifersuchtsszene zwischen den Frauen gibt, die Jonas dadurch schlichtet, daß er Angelo leidenschaftlich küßt und die Melodie von «I´m singing in the Rain» summt(...) Bis man sich, zwanzig Seiten später, Dienstag morgens vor dem Hochhaus, zu fünft (Eris Vater eingerechnet) zum gemeinsamen Ausflug an die Küste versammelt. Viel Unwesentliches wird penibel erzählt. Deswegen sollen keine Bäume sterben.“22
Finden wir hier etwa den von Hegel für den Roman (innerhalb seiner Definition der romantischen Epoche) als treibendes Prinzip angeführten Konflikt zwischen der Poesie des Herzens und der entgegenstehenden Prosa der Verhältnisse? Oder tendiert Krausser mit der Wahl des „Dingsymbols“ Karton und den unerhörten Begebenheiten innerhalb seiner Erzählung nicht eher zur Novelle? Überwiegt nicht das Ereignis „toter Vater im Karton“ jegliche Andeutung eines umfassenderen Gesellschaftsbildes, wie es uns der Erzähler in diesem Fall konsequent vorenthält: „Natürlich hat Liz eine Vorgeschichte. Die ist eher belanglos.“23 Einem weiteren, für den Roman nahezu konstitutiv wirkenden Prinzip, nämlich der detaillierten Figuration der Protagonisten und deren Positionierung als „problematische Individuen“ in einer „kontingenten Welt“(Georg Lukács) und der damit verbundenen, überwiegend psychologisch imprägnierten Romantradition seit dem 18. Jahrhundert, wird im „Deleted Chapter“ eine ironische Absage erteilt:„Trotz manch brillanter Schilderung leidet das Kapitel daran, daß es schleppend erzählt ist, sich in psychologischen Exkursen verirrt und im Grunde nur Vorhersehbares enthält. In der Collector´s Edition wird es unter dem Bonusmaterial erscheinen, für all jene, die meinen, darauf partout nicht verzichten zu können.“24
Soviel stilsicheren Witz, der sich stilsicher in eine inszenierte Ambiguität einhüllt, findet man selten. Da muss es (fast) zur Nebensache verkommen, dass sich Eris Mutter ein zweites Mal in Eris Vater verliebt und der Karton mit dessen Leiche bei einem gemütlichen Spaziergang am Meer am neuen Traumpaar vorbeischippert.
In „Lederfresse“(nur echt mit der „WRROOMMM Kettensäge“), das bereits aufgrund seiner dramaturgischen Konzeption exemplarisch für Kraussers dramatisches Werk gelten kann, heißt es während einem der zahlreichen Dialoge dieses Zwei-Personen-Beziehungsdramas einmal:„Aber die Welt kann auch schön sein, weil du schön bist.“25 Dieser Satz könnte auch bei so vielen anderen Autoren stehen und wäre nichts als plumpes Liebesgeflüster, ehe die Liebenden in den Sonnenuntergang hineinlieben und sich ganz verliebt in sich und ihre Liebe verlieben. In einem Krausser-Drama wie „Lederfresse“ dringt jedoch die Außenwelt in Form der Staatsgewalt in das Refugium ein, ein Schuss, ein Tod, als Schlusswort muss ein trotziges „Peperoni“ reichen. Der Effekt dieser Zeile ist dabei schlicht eine grandiose Umkehrung der üblichen Kontrastierungsschemata der meisten Liebesgeschichten, in denen groteske Elemente als brachialer Einschnitt in die Idylle fungieren, während es bei Krausser meist genau umgekehrt vollzogen wird. Unmittelbar vor der Liebeserklärung erleben wir als Leser die medial verwirrte Normalität dieses Paares, dessen männlicher Part in seiner Verkleidung als Filmmassenmörder Leatherface vor allem amourös in Wallung gerät:„Die Säge beschützt dich. Sie rumort, sie grollt, sie surrt, und auf der schwächsten Stufe säuselt sie verliebt.“26 Eine in sich konsistent glückliche Beziehungsgeschichte zwischen zwei Buchdeckeln, die den Namen Helmut Krausser führen dürfen? Eigentlich nicht wirklich vorstellbar, denn seine Figuren tragen neben ihrer sexuellen Frustration stets die damit gekoppelte Last des Todes (ein weiteres, besonders markantes Beispiel aus Kraussers Oeuvre wäre hierzu neben Konrad Johanser Arndt Hermannstein aus dem Roman „UC“) und des Scheiterns. Oder sie scheitern, wie Stan in der „Kartongeschichte“, gerade daran, eben nicht zumindest grandios scheitern zu können:„Stan war weniger gutaussehend, weniger begabt, weniger beliebt, weniger mutig. Neben Alfred war er in dieser Familie nie mehr als ein Mitläufer gewesen. Immerhin, in den Augen seiner Eltern hatte Stan eine neue Qualität bekommen. Stan war am Leben.“27
Helmut Krausser darf niemals aufhören zu schreiben, denn er ist – neben Autoren wie Thomas Hettche oder Daniel Kehlmann – einer der wenigen Literaten, die Literaturwissenschaftler genauso faszinieren können wie Leser, die sich auf literarische Grenzgänge zwischen Sexualität und Obsession, klassischen Topoi der Kulturgeschichte und deren Aktualisierungspotenzial innerhalb spannender Konflikte und ungewöhnlicher, zuweilen poetologisch autoreflexiver Erzählmuster einlassen wollen.
„Soweit der aktuelle Stand der Geschichte. Vieles scheint möglich, in der einen oder anderen Richtung. Das ist wunderbar und groß. Wie das Leben selbst. Menschen kommen und gehen, selbst Katzen verschwinden für immer. Kein Tropfen Wasser in unseren Körpern, der nicht zuvor in ungezählten anderen Dienst tat. In Menschen, Katzen, Rosen oder Pfirsichen(...) Ein Buch, das nicht lügt, muß dem Leben gleichen. Irgendwann, oft ganz plötzlich, ist Schluß, der Vorhang fällt mitten auf dem Gabentisch – besser, man gewöhnt sich beizeiten daran“28 , heißt es bilanzierend am Ende der „Kartongeschichte“. Eine finale Bestandsaufnahme einer beeindruckend produktiven Schaffensperiode? Krausser hört man am besten mit Krausser auf. Aber bitte nicht mit 45; auch wenn zumindest der Lyriker in jedem Fall bleiben möchte. „So. Jetzt Feierabend.“29
1
Krausser kündigte seinen Rückzug – zumindest von der Prosa – bereits mehrmals in verschiedenen Interviews an (etwa in der 8. Ausgabe der Interview-Zeitschrift GALORE aus dem Jahre 2005). Einige der raren Interviews mit Krausser finden sich unter einem entsprechenden Link auf der Fanseite: www.helmut-krausser.de (letzter Aufruf: 28.3.2007). Die für diesen Text verwendeten Zitate aus einigen Interviews basieren auf den Angaben dieser Webseite.
2
Helmut Krausser: Thanatos. München, 1998, S. 12.
3
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann: Die Bergwerke zu Falun. Der Artushof. Stuttgart 2004, S. 47.
4
Helmut Krausser: Thanatos. München, 1998, S. 94.
5
Ebd., S. 94.
6
Ebd., S. 21.
7
Ebd., S. 21.
8
Ebd., S. 422.
9
Interview in: GALORE, Nr. 8, 2005.
10
Ebd.
11
Vgl. dazu eine von Kraussers provokanten Äußerungen in einem Interview, das er mit Sebastian Fasthuber geführt hat (www.helmut-krausser.de):„Gerne schrieb ich noch ein paar Stücke, einfach, weil ich da noch etliche Möglichkeiten sehe, der Bühne etwas Neues zu geben. Aber angesichts des Triumphes der Scheiße momentan auf Bühnen und Spielplänen, weiß ich nicht, ob das noch Sinn hat.“
12
Ebd.
13
Ebd.
14
Helmut Krausser: Stücke 93-03. Frankfurt am Main 2003, S. 94.
15
Helmut Krausser: Kartongeschichte. Hamburg 2007, S. 5.
16
Ebd., S. 5.
17
Ebd., S. 5.
18
Ebd., S. 9.
19
Ebd., S. 7.
20
Hugo von Hofmannsthal: Der Brief des Lord Chandos. Schriften zur Literatur, Kultur und Geschichte. Stuttgart 2000, S. 52.
21
Helmut Krausser: Kartongeschichte. Hamburg 2007, S. 32.
22
Ebd., S. 89.
23
Ebd., S. 26.
24
Ebd., S. 91.
25
Helmut Krausser: Stücke 93-03. Frankfurt am Main 2003, S. 42.
26
Ebd., S. 42.
27
Helmut Krausser: Kartongeschichte. Hamburg 2007, S. 28.
28
Ebd., S. 139.
29
Ebd., S. 139.
Dieses Portrait erschien in leicht veränderter Form als Erstveröffentlichung unter: https://www.medienobservationen.lmu.de/
Herzlichen Dank an Herrn Schlicker für die freundliche Überarbeitung/Überlassung
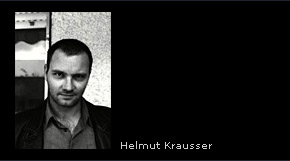
zuletzt aktualisiert im Februar 2026


