• Tonträger
• CD-Tipps & Beste Alben
• Besuchte Konzerte
• Video / DVD
• Links zu Bands
• ROLLING STONE: Musik News
• HELMUT KRAUSSER
- Aktuelles
- Lesungen / Termine
- Werkverzeichnis
- Wer hat uns je geliebt?
- ![]() Freundschaft
Freundschaft
und Vergeltung
- Trennungen, Verbrennungen
- Zur Wildnis:
45 Kurze aus Berlin
- Puccini Roman
- Einsamkeit + Sex + Mitleid
- Eros
- Portrait
- Interviews
- Leseproben
- Lyrik
- Tagebücher
- Deutschlandreisen
- Kraussers Lieblingsbücher
- Krausser & Klassische Musik
- Der Komponist Helmut
-
Krausser
• BIBLIOTHEK / BELLETRISTIK
• MUSIKBIBLIOTHEK
Tagebücher

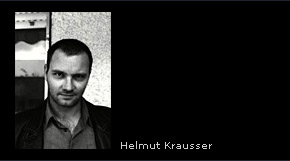

Daniel Kehlmann über Helmut Kraussers Tagebuchprojekt
Unter amerikanischen Autoren der zwanziger Jahre war viel davon die Rede, daß man sich nicht an Hollywood verkaufen dürfe. „Selling out to the movies“ war eine realistische Möglichkeiten für jeden Schriftsteller, der einigen Erfolg gehabt hatte: Faulkner, Fitzgerald und Odetz ergaben sich in Kalifornien dem Alkohol, selbst Hemingway entkam nur knapp. Jede Begabung schien bedroht, vom Geld und Glamour des Filmgeschäfts aufgesogen zu werden.
Auf den deutschen Autor der Gegenwart, das kann man getrost behaupten, lauert diese Gefahr nicht. Hollywood verzichtet großmütig darauf, ihn in Versuchung zu führen; die Glitzerwelt des Films hat es auf seine Seele nicht abgesehen. Auf ihn lauert die prosaischere Verführung des Funktionärsdaseins: Von allen Seiten schlägt ihm die Nettigkeit eines Betriebes entgegen, der ihn am liebsten ununterbrochen in Jurys sähe, auf Autorentreffen, bei Lesefestivals und Rundfunkdiskussionen, als Vortragender in städtischen Bibliotheken. Das Zerstörerische dieses Daseins liegt nicht bloß darin, daß es einen vom Schreibtisch fernhält, sondern, subtiler noch, daß sich ganz von selbst das unter solchen Bedingungen Geschriebene auf einen Ton vorsichtigen Mittelmaßes stimmt, auf ein abgesichertes, vortragssaalkompatibles Niveau, das schon vorneherein weiß, was ihm die Zustimmung des professionellen Publikums eintragen wird, und das darüber hinaus keine Risiken eingeht.
Ein Autor, der wissen möchte, wie man dieser Gefahr entgeht, sollte die Tagebücher seines Kollegen Helmut Krausser lesen. Es gibt zur Zeit kein besseres Dokument darüber, was es heißt, am Ende des zweiten und zu Beginn des dritten Jahrtausends ein deutscher Schriftsteller zu sein.
„Der Mai begann fürchterlich.“ Mit diesem Satz nahm am 1. Mai 1992 das Großunternehmen seinen Anfang. Zwölf Monate lang wollte Helmut Krausser jeweils einen Monat lang Tagebuch führen: dem Mai 1992 würde also der Juni 1993 folgen und so fort. Die ersten Reaktionen waren verständnislos. Warum gerade der Mai ’92 fragte ein Rezensent, da sei doch gar nichts passiert, andere zuckten verwirrt die Achseln: Wer beginne denn noch Projekte, die auf ein Dutzend Jahre angelegt seien? In einer literarischen Welt, die Bücher kaum noch anders denn als Tagesereignisse wahrnehmen konnte, mußte Kraussers Absicht sehr fremdartig erscheinen – und vor allem wie etwas, das verurteilt sein würde, Fragment zu bleiben.
Mit dem April 2004 kam das Unternehmen zum Abschluß. Die Wette ist gewonnen: Krausser lebt noch und ist wohlauf, weder der Verlag, noch das Publikum, noch er selbst haben unterwegs das Interesse verloren – trotz des schlechten Zeichens am Anfang. „Der Mai begann fürchterlich.“ Eine Amsel fliegt gegen Kraussers frischgeputzte Fensterscheibe und verendet, fürwahr ein übles Omen, qualvoll. Der Besitzer des Unglücksfensters hat gerade den Obdachlosenroman „Fette Welt“ veröffentlicht und ist in der Schlußphase des historischen Epos „Melodien“. Der Ton seiner täglichen Notate, noch deutlich geschult an den Vorbildern Bertolt Brechts und Ernst Jüngers, ist geprägt von konzentrierter Leidenschaft, vom klaren Selbstbewußtsein jemandes, der weiß, daß er gerade ein wichtiges Buch beendet. Ein Jahr später ist „Melodien“ erschienen und einerseits sehr erfolgreich, andererseits weit weniger, als es diesem Roman gebührt hätte: Noch reagiert der deutsche Journalismus auf erzählende Texte erschrocken und unmutig (und es ist nicht zuletzt Kraussers Verdienst, daß sich das inzwischen geändert hat). Krausser fährt als Favorit nach Klagenfurt, erlebt das Konkurrenzklima unter den Autoren, die Machtspiele der Jury, die Aufdringlichkeit der Journalisten, die Übermacht des Geredes über die Kunst und verliert zugleich den Wettbewerb wie auch seine letzten Illusionen.
Nichts Besseres hätte ihm passieren können. Im nun entstandenen Spannungsfeld zwischen Rückzug und Anteilnahme reichen Kraussers Tagebücher an die größten der Gattung heran. Wie die Diarien von Pepys und den Goncourts leisten sie zweierlei: Sie legen Zeugnis ab über Gesellschaft und Politik eines Zeitalters, zugleich formen sie ein trotz aller Stilisierung kompromißloses Selbstporträt. Nach dem Klagenfurt-Auftritt verweigert sich Krausser konsequent dem Fernsehen und gibt kaum noch Interviews. Mögen die Medien einen Autor heute auch dazu drängen, ein verfälschtes und verkitschtes Bild seiner Person neben das eigene Werk zu stellen, so dreht Krausser den Spieß um: Er macht die Herausstellung seines Ichs, seiner Wünsche und Traurigkeiten, seiner Eitelkeit, seines Größenwahns, seiner Augenblicke der Inspiration und Lethargie, zum zentralen Teil des literarischen Werks.
Größenwahn? Ein Vorwurf, den Krausser sich oft anhören mußte. Tatsächlich, er macht sich nicht kleiner, als er zu sein meint; er verweigert die vom Literaturbetrieb verordneten Bescheidenheitsgesten. Wen das stört, der hat nicht verstanden, daß ein solches Tagebuchunternehmen ohne Ehrlichkeit nicht funktioniert - nicht jener journalistischen Ehrlichkeit, die jedes Ereignis wiedergibt und kein Detail verschweigt, sondern der literarischen, die es sich versagt, das eigene Selbstbild ins höflich Nette zu verfälschen: Kein Schriftsteller hält die eigene Arbeit für durchschnittlich; wer es dennoch behauptet, lügt; und Krausser lügt nicht. Der Leser wird Zeuge seiner Ausfälle ebenso wie seiner Selbstzweifel, seiner Freude über Erfolge wie auch seines Ärgers etwa über eine Theaterwelt, die sich zu großen Teilen hartnäckig weigert, den Autor eines der meistgespielten deutschen Stücke der letzten dreißig Jahre („Lederfresse“ bringt es mittlerweile auf 270 Inszenierungen weltweit) auch auf deutschen Subventionsbühnen aufzuführen.
Doch Krausser hat früh verstanden, daß auch Abgrenzung eine Form der Neurose werden, daß das Einsiedlerleben à la Botho Strauss eine für die Wahrnehmung der Welt nicht geringere Gefahr als das Funktionärstum sein kann. Vor ihr jedoch bewahrt ihn seine schlechthin universale Neugier.
Kraussers nimmt jeden anlaufenden Kinofilm zur Kenntnis, er wartet gespannt auf literarische Neuerscheinungen, Erkenntnisse zur antiken Numismatik sind ihm ebenso wichtig wie die jeweils nächste PC-Version von „Tomb Raider“, und die Tagebücher dokumentieren sein fortlaufendes Gespräch mit Freunden und Kollegen. Seite für Seite sind sie durchzogen von einer Offenheit und Begeisterungsfähigkeit, die von keiner Enttäuschung und keiner Künstleregozentrik abgestumpft werden können: Der erste Besuch von „Lola rennt“ stachelt ihn zu hymnischer Prosa an, seine Freude über Bücher von Thomas Hettche oder Jonathan Franzen ist schlechthin entwaffnend. Daß Theaterkritiker überhaupt nichts verstünden, überlegt Krausser am 1. Oktober ’97, rühre vielleicht daher, daß sie in Theatern hockten, während anständige Leute fernsähen. Das ist mehr als ein guter Witz: Krausser, Experte für das antike Rom und Autor des besten Romans über Renaissancemagie, fühlt sich ebensowenig wie sein Antipode Rainald Goetz erhaben über die populäre Kultur; er weiß, daß eine innovative Serie wie „Babylon 5“ vielem vom Kulturbetrieb Hochgehaltenen überlegen ist und Gewichtigeres über unsere Welt aussagt als die meisten Berliner Spielpläne.
Das Tagebuch an sich ist eine monologische Gattung. Mit einem Kunstgriff, der weit mehr ist als das, weiß Krausser diese Einschränkung zu umgehen: Seine Frau Beatrice wird zum ständigen Gesprächspartner, zum Gegenpart, einer zweiten Stimme, deren Witz und Widerspruchsgeist nie aufhören zu erfreuen. Er verlasse sie jetzt, sagt ihr Krausser einmal im Scherz, worauf Beatrice antwortet: „Ich komm mit. Verlassen wir mich gemeinsam.“ Von solchen Sätzen kann man schwer genug bekommen, und bald schon ist man süchtig nach ihren von der Emphase des Autors stets so herrlich unbeeindruckten Kommentaren. Natürlich aber ist es eben dieser Autor selbst, der ihre Kommentare eingebaut und durch sein Arrangement zu Literatur geformt hat. So sind die Tagebücher auch, formal wie inhaltlich, das Hohelied auf eine offene, gerade dadurch symbiotische Zweierbeziehung.
Zunehmend weicht mit den Jahren die Aggression und macht in Stil und Tonfall einer humorvollen Gelassenheit Platz. Kraussers vielleicht vollkommenster Tagebuchmonat ist der November 1998. Hier trifft alles zusammen: „Lola rennt“ hat Italienpremiere, das Ehepaar spaziert durch Rom, wieder einmal erweist sich Krausser als Virtuose der Absage („Da haben aber etliche zugesagt, die sind mindestens so berühmt wie du!“ – „Na also, dann brauchst du mich gar nicht.“) und hängt Überlegungen zur Natur der Zeit nach, die später in den Roman „UC“ einfließen werden. Philosophie und Fernsehen also, Antike und Kino, dazwischen immer wieder die Frage, wer Helmut Krausser eigentlich ist: „Ich bin ungerecht, jähzornig, eitel, unduldsam, selbstbezogen, arrogant, nachtragend, vorlaut, sicherheitsbedürftig, besserwisserisch, zu wenig hilfsbereit, intolerant und leicht verletzbar – und unternehme nichts dagegen, weil es sich um Eigenschaften handelt, die allesamt der Kunst förderlich sind. Mein Ich ist ein Projekt, kein Mensch.“
Ein Projekt, dessen Facetten die Tagebücher zu einem vielfältigen Porträt arrangieren. Über die Vorlieben der Zukunft zu spekulieren, ist immer schwierig; diese Diarien aber werden gelesen werden, solange Menschen sich für deutsche Literatur interessieren. Lohnend wäre es allerdings zu wissen, wie man sie später kommentieren wird. Aus heutiger Sicht mag es aussehen, als lebten wir in den Jahren der hochgelobten Achtzigseitendebüts, der feuilletonistischen Müdigkeit, des Jelinek-Nobelpreises und der subventionierten Theaterlangweile. In der Rückschau aber könnte es sich erweisen, daß es vielmehr die Zeit von „Melodien“, „Thanatos“ und „UC“ gewesen sein wird, die Zeit von „Haltestelle, Geister“ und eines hochreflektierten, in zwölf Bänden festgehaltenen Künstlerlebens. Mit anderen Worten, die Zeit Helmut Kraussers.
April
Aus Helmut Kraussers Tagebuch des April 2004
Da fällt mir etwas schwer Verdrängtes ein. Beim Schreiben von Fette Welt hab ich zuletzt daran gedacht, hab es dort aber nicht aufgeschrieben, ich weiß nicht genau warum, wohl, weil mir der Zusammenhang mit meiner späteren Denkart nicht klargeworden ist.
Die fiese Clique aus der Weißnichtmehrwiesiehieß-Straße, jedenfalls eine sehr nahe Straße, keine hundert Meter, dennoch Welten entfernt. Das waren ein paar Jugos oder Türken, keine Ahnung, der Unterschied existierte damals nicht. Sie faszinierten mich, weil sie nur vier Jahre älter waren als ich, doch in meinen Augen fast erwachsen. Hin und wieder
sah ich ihren Freizeitvergnügungen zu. Sie spielten nie Fußball oder sonst was in der Art, sie lungerten herum oder taten verborgene Dinge, was sich nach mordswas anhört und vielleicht so viel gar nicht war. Mir schien es so, als unterstützten sie ihre Familien – wären bereits in den Unterhaltsplan ihrer Sippe einbezogen gewesen, weniger vage kann ich das nicht formulieren, die Erinnerung ist nicht sehr stark und auf wenige kurze Szenen beschränkt.
Wir Kinder aus der verbürgerlichten Parallelstraße hatten Angst vor ihnen, das ist sicher, und die Zeiten, als wir aufeinander mit Erbsenpistolen schossen, als wir noch Spaßkriege führen konnten, ohne einander zu verstehen, als nachgeahmte Schießgeräusche genügten - sie lagen real nur ein paar Monate zurück, in gefühlter Zeit jedoch Jahrzehnte.
Einmal aber fuhr ich mit dem Rad aus meiner Welt heraus in ihre. Es waren Jugos, glaube ich, damals waren es noch Jugos, weder Serben noch Kroaten noch Bosnier. Einfach Jugos. Kinder einer etwas bräunlicheren Hautfarbe als meine.
Mit einem Orangennetz hatten sie den flugunfähigen Spatz auf dem Radweg festgemacht, mit Tesafilm festgeklebt, und weil der Tesafilm nicht klebte auf dem Asphalt, die Enden des Netzes mit Reißnägeln in den hitzeweichen Boden getrieben. Der Vogel flatterte und piepste.
Protestierte.
Sie führen mit Bonanza-Rädern über ihn, um zu sehen, inwieplatt sie ihn zerquetschen konnten.
Ich war zu klein, um mich gegen diese blutgierigen Jugendlichen durchzusetzen oder Widerspruch auch nur zu wagen.
Aber schon damals sagte eine Stimme in mir: Der Spatz stirbt ohnehin, besser so, als von einer Katze gefressen zu werden, er wird ein schnelles Ende haben.
Vielleicht prägte mich jenes Ereignis derart, daß mein Pragmatismus sich künftig gegen jedwede irrationale Emotion durchzusetzen wußte. Noch heute'sehe ich den Spatz genau vor mir.
Ein plattgefahrenes Etwas, der Kopf im letzten Schrei erstarrt, der Rest eine Lache Blut mit braunen Federn. Ich war sechs Jahre alt.
Relativitätstheorie - das ist, wenn der Stürmer alleine auf den Torwart zuläuft, aber das Tor immer kleiner wird.
Krämerisch, die Wichtigkeit der Literatur daran zu messen, ob sie etwaige Massen erreicht.
Massen sind amorph, fangen nirgends an, hören nirgends auf. Mit dem Einzelnen ist zu rechnen.
Es gibt Literatur, die es darauf anlegt, zwei oder drei Menschen zu erreichen - und damit viel größere Wirkung erzielt - wenn es nur die richtigen sind. Gewisses Material veröffentlicht man gar nicht für alle, sondern nur, damit es vorhanden bleibt, bis ein anderer damit den nächsten Schritt tut.
Daß einem ein solcher Gedanke den Vorwurf des Selbstbetrugs einbringt, ist in Ordnung. Er gründet sich auf-heute noch nicht nachprüfbare, vorhergesehene, vielmehr vorausgeträumte Wirkungen. Treffen diese nicht ein, steht man nicht etwa blöd da, man steht überhaupt nicht mehr da, niemanden kümmert es.
Themen des Tages sind die Unruhen im Irak und - beinahe gleichberechtigt wichtig – die Seitensprünge des David Beckham. Ich will nichts über den Sex anderer wissen, sei denn, der Betreffende vertreibt ihn preiswert per Homevideo. Sex ist gut, mehr Sex ist besser, jeder sollte soviel Sex haben, wie er für richtig hält. Alles andere ist Doris Day, geht mich nichts an. Ich warte auf den ersten Prominenten, der sich vor die Medien hinstellt und sagt: „Ich habe Sex, so viel ich will und kriegen kann, und das ist völlig natürlich."
Und sollte ihm die Frage gestellt werden: „Aber was sagt Ihre Frau dazu?", müßte er antworten: „Wohl bekomms!" Und die Frau, sollte man ihr ein Mikro unter den Mund halten, könnte als einzigen Kommentar drauf spucken, dann wären Idylle und Verwirrung komplett.
Ich berichte über den Lobster, den ich gekauft, aufgetaut, geknackt und gebraten habe, um ein majestätisch schönes Tier seiner Totenwürde zu berauben.
Bea faßt zusammen: „Du hast ihm die Eingeweide rausgerissen und in deine gestopft."
Bei Arbeit an der Erzählung Benennungsproblem: Ab wann genau gilt ein Loch als Grab? Erst dann, wenn man einen Kadaver darin hinterlegt, oder bereits ab dem Moment, in dem man das Loch aushebt, um darin später einen Kadaver (welcher Art auch immer) zur letzten Ruhe zu betten? Zählt ein faktischer Inhalt, oder die bloße Intention, vom ersten Spatenstich an?
Kann eine kaum dreißig Zentimeter tiefe Kuhle schon als Grab bezeichnet werden? Als Grab im Werden? Reicht gar die ausgesuchte Stelle hin, an der man zu graben beginnt? Grabstätte. Dieses Wort benötigt keinerlei Füllmasse, ist ein Ausweg, Kompromiß, Umschreibung, Umschiffung des Problems.
Ob nicht die Gefahr bestünde, fragte Rilke Hofmannsthal, der ihn zu einer Lesung nach Wien einlud, daß häßliche Menschen anwesend seien?
Nein, antwortete Hofmannsthal, er könne für die Buchhandlung garantieren, häßliche Menschen verkehrten dort nicht.
Ich überlege noch, ob ich Rilkes Frage oder Hofmannsthals Antwort bizarrer finden soll.
Picasso, erzählte mir Daniel auch noch, sah ein schönes Haus, zeichnete das Haus, verkaufte die Zeichnung und kaufte das Haus. Das ist Bildmacht.
Dosenbierleptosomen, die bleichen schmalen Fressen vom Wind verzerrt zu unabsichtlich obszönen Fratzen, wiegen ihre für Dosenbiergräber auffallend dürren Gestelle, stehen so rum, tätowiert, beschwipste menschliche Zitterpappeln in fleckigen Jeans und Turnschuhen (Schultheiss), manchmal Cowboystiefeln (Becks). Von ihren Stammparkbänken des Paul-Lincke-Ufers aus echauffieren sich schaumweingesättigte Witwen über Rotweinpenner und deren kackende Hunde. Der Alkohol und seine Hierarchien.
Die vielen kleinen Schlupflöcher der Stadt, manche kosten Geld und sind behaart. Es gibt sie an jeder Ecke zu kaufen, man könnte sich preiswert ins Koma ficken, hätte man den Mut dazu. Die wahre Währung der Stadt ist die Ostmöse ohne Preisbindung die, wie ein ewighungriger, immerbettelnder Klingelbeutel, das Terrain der westlichen Unbefriedigung durchtaucht. Eroberungsfeldzug mit blondierten Sexuallebensmitteln.
Paris Hilton, eine Art Langbeinzombie in Hübsch, regt sich darüber auf, nur Platz 38 auf der Liste der most sexiest women alive zu belegen. Wie kommt dieses Mädel bloß zu der Meinung, überhaupt auf irgendeine Liste zu gehören, es sei denn vielleicht der Dumm & Reich-Kombinationswertung. Sowas Schaufensterpuppenhaftes würde ich nicht ficken, wenn es^für einen guten Zweck nackt und gebückt im Weg rumstünde und dadurch auch noch vom Krebs geheilt würde.
Na gut, dann vielleicht, bin ja kein Unmensch.
Im Darmtrakt der Stadt immer das alte Spiel: Angenommen, dieser vollbesetzte U-Bahn-Waggon würde durch einen schweren Sturm auf die offene See hinausgetrieben -
Welche der Frauen würde ich mir als Gefährtin wählen? Welche bekommen?
Welcher der Männer würde mir meinen Führungsanspruch streitig machen? Welchen würden wir als ersten essen in der Not?
In Gesichtern lesen, die keine Ahnung haben, von dem, was in mir wühlt. Diese unbekümmerten Menschen.
Aus:
Helmut Krausser
April
Belleville, München 2004
Helmut Krausser – Tagebuch Februar
von Bernd Pleis
Offenes Visier und durch die Mitte!
„Ich habe bei der großen Behörde vorgesprochen, für den Posten als Gott der vereinigten Zonen, lief alles prima, ich hatte den Job schon in der Tasche, dann wollten sie ein Gesundheitszeugnis, Sterblichkeit 100%, das wars dann. Scheiße."
Im Lichte der Öffentlichkeit zu stehen heißt, einem Bannstrahl ausgesetzt zu sein, einem Trägerstrahl, der einen in die Scheinwerfer zerrt und träge dort verharren lässt und vergessen lässt, weshalb man unterwegs gewesen ist" so Helmut Krausser in seinem Tagebuch "Februar", einem über 12 Jahre angelegten Projekt, welches im Mai 1992 begann und im April 2004 seinen Abschluss finden wird.
Von Trägheit allerdings keine Spur, kehrt Autor Krausser doch mit großer Glaubwürdigkeit und literarischem Geschick sein innerstes nach außen ohne Rücksicht auf Verluste. Bisher haben mich Tagebücher nie besonders interessiert, erst durch Helmut Krausser begann ich mich mit dieser Art von autobiographischer Literatur anzufreunden. Dass im Laufe eines Monats auch recht banales bzw. belangloses passiert, ist ganz selbstverständlich, wer von uns lebt schon 1 Monat in Dauerextase? Doch selbst manche unbedeutende Schilderung einer Alltagsbegebenheit, vermindern hier nicht die Leselust, da Krausser stilistisch zu überzeugen weiß! Wichtiger aber sind seine gescheiten, teils sarkastischen, intellektuellen Anmerkungen zu Themen wie dem Kulturbetrieb an sich, zur Musik, zu Erotik, zu Philosophie oder zu Grenzbereichen unseres Daseins. Vieles regt zum Nachdenken an, bietet sicherlich auch teilweise Stoff zur Kontroverse, aber nichts liegt Krausser ferner als einer Mehrheit nach dem Mund zu reden bzw. politisch korrekt zu agieren. Man muss nicht bei allen Aussagen Kraussers Meinung sein, daher geht es bei diesen Tagebüchern auch nicht, aber hier ist ein Autor am Werk der sein Handwerk perfekt beherrscht und keinen ermüdenden Sermon auf die Leserschaft loslässt. Langweilige, stromlinienförmige Autoren, die meinen Großes erschaffen zu haben, dabei doch nur endlos langweilen gibt es in diesem Land schon mehr als genug. Wie gut dass es Helmut Krausser gibt, endlich einer der den Ball nicht flach hält und erst 3 x zurückpasst, sondern direkt in den Angriff geht.
Kraussers Tagebücher: Ein intellektuelles Lesevergnügen, das man nicht verpassen sollte!
zuletzt aktualisiert im Februar 2026


